Helmzier
Die Helmzier spielte im Turnierkampf keine
Rolle, da sie eher störte. Das Tragen der Helmzierden nahm jedoch bei der
mittelalterlichen Turnierpraxis einen wichtigen Raum ein. Vor jedem Turnier
fand eine ausgedehnte Helmprobe statt, ein Zeremoniell, bei dem die Herolde
eine äußerst wichtige Rolle spielten. Wie beim Schildinhalt ist auch bei der
Helmzier die Zahl der möglichen Bilder unerschöpflich groß. Gibt die
Helmzier (auch Helmkleinod genannt) den Schildinhalt wieder, wird sie
oftmals als Hilfskleinod bezeichnet. Im Gegensatz dazu sind die
Schmuckkleinode zu sehen. Sie haben lediglich schmückenden Charakter, bzw.
Pfauenstöße, Straußenfedern, Flügel,
Federbüsche, Hörner, Geweihe,
Köcher. Die Stellung der Helmzier richtet sich dabei immer nach der
Blickrichtung des Helms.
Bei Wappen adliger Familien wurden auch Kronen auf den Helm aufgesetzt, was
bei bürgerlichen Wappen nicht üblich war und ist.
Vielfach ruht bei bürgerlichen Wappen die
Helmzier auf einem Helmwulst. Dies ist ein aus Stoffstreifen gewundener
Kranz, der in den Farben der Helmdecken dargestellt wird.
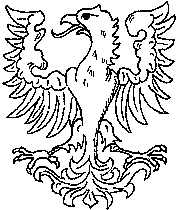 |
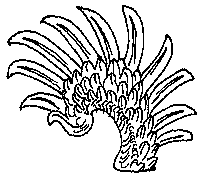 |
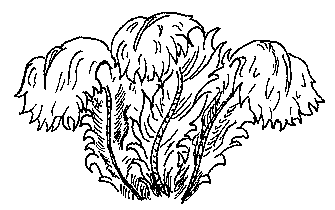 |
 |
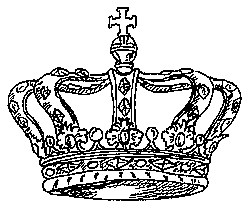 |
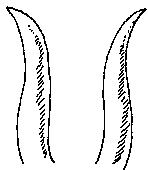 |
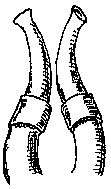 |
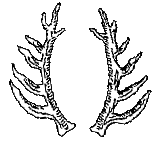 |
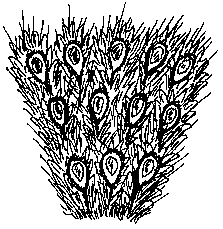 |
Helmwulst |